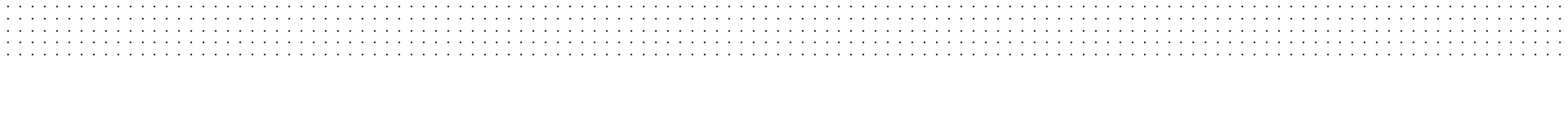Baukasten Karlsruhe
Anlässlich des zweihundertjährigen Jubiläums des Karlsruher Instituts für Technologie und seiner Vorgängerinstitutionen beleuchtet die KIT-Fakultät für Architektur in der Ausstellung „Baukasten Karlsruhe“ die gestalterischen Wechselwirkungen zwischen der eigenen Institution und der Stadt Karlsruhe.
Die am 7. Oktober 1825 ins Leben gerufene Polytechnische Schule stand in einer ambivalenten Traditionslinie: der emanzipatorische Geist der Französischen Revolution – die zuvor die École Polytechnique in Paris inspiriert hatte und zum Vorbild für Karlsruhe wurde – verband sich mit dem aufgeklärten Absolutismus, der in der Badischen Residenzstadt einen architektonischen Höhepunkt erreicht hatte. Die folgenden zweihundert Jahre der Entfaltung einer „polytechnischen Architektur“ sollten die Jahrhunderte des Wachstums und der Ausdifferenzierung der einstigen barocken Fächerstadt sein, aus der allmählich eine organisierte aber letztlich formal bruchstückhafte Ansammlung von Artefakten geworden ist. Die zunehmende Unübersichtlichkeit erfolgte nicht ohne gleichzeitige Zugewinne an einer neuen, identitätsstiftenden Gestaltungsmacht der Architektur im Rahmen einer (trotz aller Brüche und Rückschläge) zunehmend offenen Gesellschaft. Das Werden des heutigen Karlsruhes ist zu zwei Dritteln von den Bedingungen und Idealen des Polytechnischen mitgeprägt worden, auch durch seine Architektur.
Zwölf prägnante Gebäude
Die Ausstellung thematisiert die eigene polytechnische Tradition, indem sie die zentrale Bedeutung der architektonischen Bausteine für die sich entfaltende Stadt aufzeigt. Dies erfolgt anhand von zwölf besonders prägnanten Gebäuden, die im Verlauf der vergangenen 200 Jahre unter maßgeblicher Beteiligung von Mitgliedern der Architekturfakultät entstanden sind. Diese Objekte werden nach ihren operativen, syntaktischen und semantischen Wechselwirkungen mit der Stadt befragt: operativ im Sinne der sozialen Praktiken des Gebrauchs und der Produktion von solchen Artefakten, syntaktisch vor allem im Sinne der äußeren Gestalt des Stadtraums und der Infrastrukturnetze, semantisch primär hinsichtlich der symbolischen Aufladung der Artefakte und des sich über den Stadtraum spannenden Netzes an Sinnzusammenhängen. Das Zusammenwirken dieser drei Ebenen wird ebenfalls exemplarisch über die miteinander verflochtenen Themenkreise „Energie – Bewegung – Wissen“ aufgezeigt, die stets den Stadtmetabolismus mitbestimmt haben, womit auch der gestaltende Umgang mit den Bau- und Betriebsstoffen durch die gebauten Komponenten des Umweltsystems Stadt thematisiert wird. Dass dabei die Bedeutung von Architektur für die Infrastrukturnetze hervorgehoben wird, zeigt sich nicht zuletzt darin, dass die erste Fallstudie dem Brunnenhaus Friedrich Weinbrenner in Durlach sowie dem damit zusammenhängenden Brunnennetz gewidmet ist und die letzte die Haltestelle der Stadtbahn am Kronenplatz behandelt, die Prof. Ludwig Wappner mit seinem Architekturbüro konzipiert hat.
Ausgestellt werden Zeichnungen, Modelle, Fotos, und Filme, die in den vergangenen vier Semestern im Rahmen von Seminaren und Entwürfen an der KIT-Fakultät für Architektur des KIT erschlossen und generiert worden sind. Zur Ausstellung erscheint ein 200-seitiger Katalog.
Den einzelnen Fallstudien, mit ihren jeweiligen Bauwerken und ihren Wechselwirkungen mit der Stadt sind einzelne „Baukästen“ gewidmet:
01. Wasser als öffentliche Infrastruktur
Brunnenhaus in Durlach
Friedrich Weinbrenner, 1824
02. Artifizielle Gegenwelt im steten Wandel
Schaugewächshäuser des Botanischen Gartens
Heinrich Hübsch, 1852–1862
03. Ort und Praxis des Erinnerns
Kapelle des Alten Friedhofs
Friedrich Eisenlohr, 1841–1842
04. Kommunale Körperpflege
Das Städtische Vierordtbad
Josef Durm, 1873
05. Globale Verflechtungen lokaler Keramikproduktion
Großherzogliche Majolika
Friedrich Ratzel, 1901
06. Lebensgemeinschaft im Grünen
Ostendorfplatz der Gartenstadt Rüppurr
Friedrich Ostendorf und Max Laeuger, 1914–1922
07. Wohnen im Licht
Doppelhaus in der Siedlung Dammerstock
Alfred Fischer, 1928–1929
08. Psychische Dichte
Wohnblock und Ladenzeile an der Ebertstraße
Hermann Alker, 1929–1930
09. Haus- und Weltentwurf
Gartenhofhäuser „back-to-back“ in der Waldstadt
Karl Selg, 1956–1959
10. Erdölstadt: Funktionalismus vs. Pragmatismus
Sozial- und Verwaltungsgebäude der Raffinerie DEA-Scholven
Egon Eiermann, 1961–1963
11. Ein Belvedere über dem Verkehr
Brückenbau „Ponte Rosso“
Gernot Kramer, 1978–1982
12. Raumkompositionen im Untergrund
Haltestelle Kronenplatz des Stadtbahntunnels
Ludwig Wappner, allmannwappner, 2004–2021
Konzeption und Koordination
Konzipiert, koordiniert und herausgegeben von Federico Garrido,
Joaquín Medina Warmburg und Marco Silvestri
Professur Bau- und Architekturgeschichte, Institut für Kunst- und Baugeschichte am Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
Mit Beiträgen aus den Professuren
Baukonstruktion (Prof. Ludwig Wappner)
Bauplanung (Prof. Simon Hartmann)
Bau- und Architekturgeschichte (Prof. Dr. Joaquín Medina Warmburg)
Internationaler Städtebau und Entwerfen (Prof. Dr. Barbara Engel)
Raum und Entwerfen (Prof. Marc Frohn)
Stadtquartiersplanung (Prof. Markus Neppl)
Stadt und Wohnen (Prof. Christian Inderbitzin)
Ausstellungsorte und Termine
Regierungspräsidium Karlsruhe
Am Rondellplatz (Karl-Friedrich-Straße 17), Foyer
76247 Karlsruhe
8. September bis 5. Oktober 2025
Öffnungszeiten: Mo.–So., 11–18 Uhr
Finissage: 5. Oktober, 18 Uhr
KIT-Fakultät für Architektur
Englerstr. 7, Foyer im 1. Obergeschoss
76131 Karlsruhe
3. bis 28. November
Vernissage: 5. November, 19 Uhr
Öffnungszeiten: Mo.–Fr., 8–19 Uhr
Katalog
Federico Garrido, Joaquín Medina Warmburg, Marco Silvestri (Hrsg.)
Baukasten Karlsruhe - 200 Jahre Polytechnische Architektur
Karlsruhe, KIT-Fakultät für Architektur 2025
(200 Seiten mit farbigen Abbildungen, broschiert)