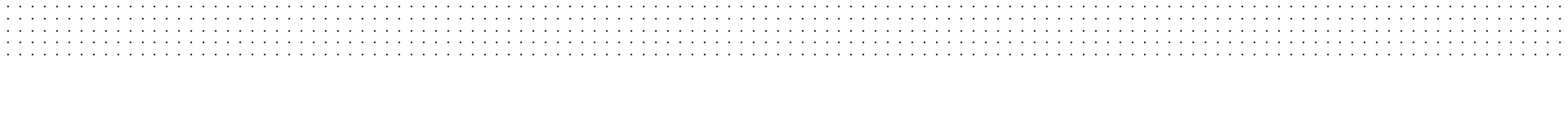Vom Bahnhof in die Geschichte: Baden-Baden zwischen Welterbe, Verkehrsanbindung und urbaner Identität

Im Seminar „Städtebauliche Typologien – Werkstatt Architektur-Journalismus: Wir schreiben über Architektur“ beschäftigen sich Studierende an der Professur Stadtquartiersplanung mit Architekturjournalismus. Dozent ist der Redakteur und Bauhistoriker Ulrich Coenen.
Die 17 Seminarteilnehmer:innen recherchieren unter Anleitung und verfassen Beiträge über Architektur, Stadtplanung und Denkmalpflege. Dabei werden verschiedene journalistische Darstellungsformen geübt.
Ein Schwerpunktthema war die Kurstadt Baden, seit 2021 UNESCO-Weltkulturerbe. Der Dozent, der Spezialist für Kurstädte und ihre Architektur ist, führte die Seminarteilnehmer:innen in einem Vortrag in das Thema europäische Kurarchitektur ein. Es folgte eine Exkursion nach Baden-Baden. Anschließend wurden drei Gespräche mit Fachleuten geführt: Nobuhiro Sonoda, Vorsitzender des Kammergruppe Baden-Baden/Rastatt der Architektenkammer Baden-Württemberg, Thomas Schwarz, Lt. Stadtbaudirektor und Leiter des Amts für Stadtentwicklung und Baurecht der Stadt Baden-Baden und Dr. Eva Zimmermann, Leiterin der Abteilung Kulturelles Erbe / Welterbe der Stadt Baden-Baden.
Selina Hofstetter hat eine Reportage über die Herausforderungen für Baden-Baden geschrieben:
Selina Hofstetter
Vom Bahnhof in die Geschichte: Baden-Baden zwischen Welterbe, Verkehrsanbindung und urbaner Identität
Was bringt die Auszeichnung der UNESCO für die Stadtentwicklung der Kurstadt?
Baden-Baden an einem außergewöhnlich heißen Samstagnachmittag im Juni. Man wünscht sich nichts mehr, als sich mit einem kalten Getränk in der Hand an einem Schattenplatz abzukühlen.
Die Szenerie wirkt wie arrangiert: Ein wolkenloser Himmel spannt sich über das Oos-Tal, das Licht modelliert die Fassaden. Der Kurpark, in sorgfältiger Komposition zwischen Natur und Baukunst angelegt, entfaltet sich als grüne Bühne. Trinkhalle, Kurhaus mitsamt Casino und Theater bilden ein Ensemble verschiedener Architekturstile des 19. Jahrhunderts. Doch hinter dieser malerischen Kulisse verbirgt sich eine zentrale Frage: Wie kann die Kurstadt, kürzlich als UNESCO-Welterbe ausgezeichnet, ihre historische Identität bewahren und gleichzeitig den wachsenden Verkehr und Tourismus bewältigen?
Die Stadt als Inszenierung, gebaut für das Flanieren, für die Begegnung und für das Repräsentieren. Heute dient diese Kulisse einem neuen Publikum: Brautpaare, ausgestattet mit voluminösen Kleidern und fotografischer Entourage, nutzen die architektonische Ordnung als Projektionsfläche für private Inszenierungen. Der öffentliche Raum, einst konzipiert für die Gesellschaft des 19. Jahrhunderts, wird temporär zur Bühne eines digitalen Zeitalters.
Baden-Baden war nie nur für das Großbürgertum konzipiert. Adel, Künstler und Intellektuelle gehörten zu den prägenden Figuren jener Zeit. Der Architekturhistoriker Ulrich Coenen, Spezialist für Kurstädte und ihre Architektur, beschreibt die Kurstadt als urbane Sonderform und „Labor der Moderne“, in dem sich gesellschaftliche, städtebauliche und kulturelle Entwicklungen verdichteten.
Um 75 n. Chr. gründeten die Römer an den heißen Quellen die Kurstadt, die vor allem der Erholung von Legionären diente. Der römische Name Aquae blieb bis heute erhalten und wurde zu Baden-Baden weiterentwickelt. Dieser antike Ursprung prägt die Stadt über das Mittelalter bis heute: Historische Bauwerke, Kurparks und kulturelle Einrichtungen verbinden sich zu einer städtischen Identität, die Wellness, Kultur und Erholung in einzigartiger Weise vereint.
UNESCO-Welterbe: Historie und Verantwortung
Die Stadt Baden-Baden ist heute Teil des transnationalen Welterbes „Great Spa Towns of Europe“. Mit der Aufnahme in die Liste der UNESCO-Welterbestätten wurde 2021 offiziell anerkannt, was sich in der historischen Baugestalt der Stadt seit dem 19. Jahrhundert manifestiert. Baden-Baden ist, wie Coenen betont, die am besten erhaltene deutsche Kurstadt, denn sie blieb im Zweiten Weltkrieg von Zerstörung weitgehend verschont.
Repräsentative Architektur, Landschaftsgestaltung und gesellschaftlicher Anspruch verbanden sich hier zu einer Synthese, deren Erhalt heute nicht nur musealer Pflege bedarf, sondern konzeptioneller Weiterentwicklung. Baden-Baden hat den Titel „Weltkulturerbe“ zusammen mit zehn weiteren europäischen Kurstädten des 19. Jahrhunderts in insgesamt sieben Ländern erhalten. Sie tragen gemeinsam die Verantwortung für die weitere Entwicklung dieses Erbes.
Der öffentliche Verkehr als Herausforderung
Wer Baden-Baden nicht nur über Postkarten kennenlernen möchte, sondern mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen will, erlebt zunächst den Bruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Der historische Bahnhof liegt abseits, im Stadtteil Oos, fünf Kilometer entfernt vom eigentlichen Zentrum. Angekommen steigt man in einen Bus in Richtung Kaiserallee oder Luisenstraße. Erst dort taucht man in die Altstadt mit ihrer zum Teil spektakulären Architektur.
Steigt man in der Kaiserallee aus, so bewegt man sich in Richtung wunderschöner Gartenanlagen, der Trinkhalle sowie dem Kurhaus. Ist jedoch die Luisenstraße das Endziel, so wird man von einem unschönen Leopoldplatz empfangen, welcher gerade in der sommerlichen Hitze mit seinem Straßenbelag ein unangenehmer Aufenthaltsort ist.
Eine Anbindung per Stichbahn – der ehemalige Kopfbahnhof ist heute das Foyer des Festspielhauses – existierte einst. Der Rückbau der Gleise in den 1970er-Jahren markiert einen infrastrukturellen Rückschritt, dessen Folgen bis in die Gegenwart spürbar sind. „Ein Fehler, dem man heute nachtrauern kann“, bedauert Thomas Schwarz, Leiter des Amtes für Stadtentwicklung und Baurecht der Kommune.
Die Folge dieser Entkopplung ist nicht nur logistisch problematisch, sondern berührt auch die Identität der Stadt selbst. Das Welterbe verlangt mehr als die bloße Konservierung von Fassaden. Es fordert eine Reaktivierung jenes städtebaulichen Anspruchs, der die Stadt einst geprägt hat. In der historischen Kurstadt waren Bauten und Wege Teil einer übergeordneten Ordnung. Der heutige Verkehr hingegen folgt dieser Ordnung weniger. Er ist Ausdruck eines Bruchs mit der Vergangenheit, einer Urbanität ohne Struktur.
Eine Stadt im Wandel
„Die Stadt befindet sich im Wandel“, bemerkt Nobuhiro Sonoda, der Vorsitzende der Architektenkammer Baden-Baden/Rastatt. Er ist in Baden-Baden aufgewachsen, wohnt und arbeitet als freier Architekt dort bis heute. Die Zunahme des Tourismus, durch den UNESCO-Titel befördert, wirkt sich unmittelbar auf die Verkehrsbelastung aus. Das Stadtbild leidet unter dem wachsenden Autoverkehr, vor allem durch Tagestouristen, die individuelle Mobilität bevorzugen.
Für die Stadt bedeutet dies eine wachsende Herausforderung: Wie kann ein Lebensraum erhalten bleiben, der gleichermaßen Ort des Wohnens, des Erlebens und der Erholung ist, ohne dabei vom Verkehrsaufkommen erdrückt zu werden? „Die höheren Zahlen an Tagestouristen sind eine Begleiterscheinung des Welterbe-Titels mit dem man umgehen muss“, sagt Thomas Schwarz.
Einzelne Projekte versuchen gegenzusteuern. Die „Rad-Allee“, ein Radwegkorridor vom Bahnhof bis zur Geroldsauer Mühle, soll das Tal der Oos erlebbar machen und alternative Mobilitätsformen fördern. „Verkehr und Stadtentwicklung hängen voneinander ab und sind gemeinsam zu lösen“, so Schwarz. Ein umfassendes Konzept, das dem Welterbe-Titel gerecht wird und die Mobilitätsbedürfnisse von Bewohnern und Gästen integriert, steht noch aus.
Zwischen Erbe und Zukunft
Die Stadt Baden-Baden steht damit sinnbildlich für ein Dilemma vieler Welterbestätten: Die Anerkennung durch die UNESCO bringt internationale Sichtbarkeit und touristische Magnetkraft, doch sie erzeugt auch Druck. Die denkmalpflegerische Aufgabe endet nicht beim Erhalt von Bausubstanz. Sie beginnt bei der Integration historischer Strukturen in eine zeitgemäße Stadtentwicklung. Und diese Entwicklung muss auch Fragen der Erreichbarkeit, der Infrastruktur und des Alltagslebens beantworten.
Denn das Erbe der Kurstadt besteht nicht allein in ihrer Architektur, sondern auch im Geiste dieser. Dieses Erbe ist nicht zu bewahren wie ein Fossil, sondern zu transformieren in eine Form, die dem heutigen Baden-Baden gerecht wird. Ein Welterbetitel mag die Vergangenheit ehren, doch seine eigentliche Bedeutung liegt in der Zukunft. Sie entscheidet darüber, ob Baden-Baden weiterhin Kurstadt im vollen Sinne sein kann oder ob sie zur bloßen Kulisse eines goldenen Zeitalters verkommt.





Weitere Beiträge aus dem Seminar „Städtebauliche Typologien – Werkstatt Architektur-Journalismus: Wir schreiben über Architektur“: